34 Jahre Frankfurter „Initiative 9. November e.V.“
Weil es der Frankfurter Börneplatz-Protestbewegung in den 80er Jahren nicht gelungen war, Relikte zerstörter jüdischer Monumente als öffentliche Mahnung zu erhalten, gründeten jüdische und nicht-jüdische Frankfurterinnen und Frankfurter gemeinsam 1988 die „Initiative 9. November e.V.“. Was am Börneplatz scheiterte, sollte an der Friedberger Anlage, einem vergleichbaren Tatort des antisemitischen November-Pogroms von 1938, erreicht werden.

Auch hier handelte es sich um die Zerstörung einer Synagoge, der größten Frankfurts und die umfassende Vertreibung und Vernichtung ihrer Gemeinde – Auftakt für den nachfolgenden Holocaust. Es ging der neuen Bürgerinitiative nicht nur darum, an diese Geschichte zu erinnern, sondern den Platz, der 1942/43 von einem Luftschutzbunker überbaut worden war, zu gestalten und so zu nutzen, so dass er – als Mahnung und Menetekel gelesen – zu einem engagierten Handeln gegen Wiederholungen antisemitischer und rassistischer Verbrechen beiträgt. Das Modell dafür entlehnten wir der Politik der US-Armee 1945, als sie die Menschen, die in Nachbarschaft von Konzentrationslagern lebten, zwangen, die damals noch unmittelbar sichtbaren Gräuel von Angesicht zu Angesicht anzuschauen. Wie dieses Vorgehen auf den Ort der zerstörten Synagoge übertragen werden konnte, war noch offen. Entscheidend war, dass an diesem Ort Relikte einer Verbrechensgeschichte vorhanden waren, die letztlich nicht „erinnert“, innerlich herbeigeholt werden mussten, sondern sich mit aller Gewalt und Gegenständlichkeit aufdrängten, Erinnerungen nicht eigentlich wachriefen, sondern auf imperative Weise erregten, überwältigten und überreizten.
Aber jedenfalls verlangte das von unserer Bürgerinitiative etwas Besonderes: die Menschen nicht zu belehren, ihnen etwas Fertiges zu zeigen, nicht nur aufzufordern: „Erinnert Euch!“, sondern in mehrfacher Hinsicht selbst gestalterisch, handwerklich und „archäologisch“ tätig zu werden und andere tätig werden zu lassen, damit sie in ihren eingeschliffenen Abwehrformationen, aus dem üblichen Vergessen und Relativieren, ihren „Gewohnheiten“ aufgerüttelt werden. Das hieß, am Ort manifeste Hinweise auf seine Geschichte zuerst herauszuarbeiten und dann darzustellen. Das hieß, Menschen Gelegenheiten zu verschaffen, sich hier regelmäßig zu versammeln und dabei zu einer Gruppe zu werden, die Geschichte konkret anschaulich und bewegend macht und schließlich aus einer neuen Perspektive Frankfurter Stadtgeschichte schreibt.
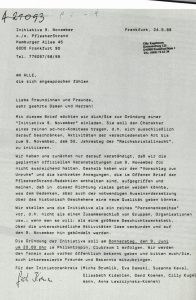
Federführend bei der Zusammenführung und Gestaltung der Initiative waren vor allem Monika Seifert-Mitscherlich, Silvia Tennenbaum , Elisabeth Abendroth, Ute Daub, Renate Chotjewitz-Häfner, Abraham Dzialowski, etwas später Diwi Dreysse, Elisabeth Leuschner-Gafga, Kurt Grünberg, der Autor, dann Edith Marcello, Hans-Peter Niebuhr, Iris Bergmiller-Fellmeth und Erika Hahn.
In diesem Resümee, das als Teil einer umfassenden Chronik zu verstehen ist, möchte ich anhand der an Ort und Stelle gemachten Erfahrungen der Frage nachgehen, inwieweit das gelungen ist, d.h. wie diese Umgestaltung dazu beigetragen hat, antisemitisches Denken und Verhalten sichtbar zu machen und zu bekämpfen.
Von Beginn an waren wir uns einig, vorrangig den an diesem Ort gegebenen speziellen zeitlichen Abschnitt und örtlichen Brennpunkt eines Überganges ins Auge zu fassen: den Pogrom vom November 1938, an dem sich die Weichenstellung, die Vorbereitung und Ausentwicklung zum Holocaust wie in einem Vergrößerungsglas abgezeichnet hat, sein Vorher im Wissen des Nachherigen. Der Blick konnte und musste hier also noch zurückgehen bis in beinahe glückliche Zeiten, in denen eine jüdische Austrittsgemeinde und auch namhafte Vertreter der Stadt glaubten, ja überzeugt waren, hier ein „Jerusalem am Main“ gegründet zu haben. Eine Religionsgesellschaft, die gleichermaßen der Modernität und der Orthodoxie verpflichtet war, insgesamt „staatstragend“, kaisertreu und bei der Eröffnung der Synagoge 1907 ein Lied mit der Melodie von „Ein Jäger aus Kurpfalz“ singen konnte. Seit 1938 steht der Ort für den historisch entscheidenden Bruch. Dazu gehört selbstverständlich der Bunker. Er vervollständigt seither Platz und Geschehen als Tatort zu einem kausal zusammenhängenden Akt.
Das erste Ziel unserer Initiative lautete, hier eine „Geschichtswerkstatt“ zu schaffen; so nannten wir das zunächst am Ort aufgestellte Container-Büro der Initiative – ein freies, nicht vorgeplantes, für jedermann offen zugängliches Projekt. Es wurde dann weitaus mehr als eine „Werkstatt“. Dazu passt, dass es schwer war, einen passenden Namen für unser Projekt zu finden, weil es alles war (und ist): Denkmal, Gedenkstätte, Mahnmal, Geschichtszentrum, Museum, Memorial, Begegnungs- und Erinnerungszentrum, ein Agglomerat, aus vielerlei Gründen geeignet, den entwickelten Ort als Ganzen als „Trude-Simonsohn-Zentrum“ zu bezeichnen, (was von der Jüdischen Gemeinde jedoch leider nicht akzeptiert wurde). Denn das, was sich hier im Lauf der Zeit inhaltlich und methodisch herauskristallisierte, folgte in seiner Besonderheit der Aufklärungsarbeit von Trude Simonsohn, die unserer Initiative immer nahestand und sie unterstütze. Aus allem hier im Laufe der Jahrzehnte Erschaffenen wurde jedenfalls ein äußerst facettenreiches Unternehmen, das – wie es kein Denkmal o.ä. vermag – als persönlicher und als kollektiver, antiautoritär organisierter Arbeits- und Präsentationsort aufgefasst und geprägt werden konnte.
Herauszuheben ist dabei, dass unser Ort zu einem Anlaufpunkt für zahlreiche Besucher entwickelt werden konnte. Er wurde Treffpunkt und Begegnungsstätte für jene, die in Zeiten der Gemeinde einen persönlichen Bezug zum Ort hatten oder im weiteren Verlauf unserer Arbeit zu einzelnen Mitgliedern der Gruppe dauerhafte persönliche Kontakte herstellten. Das gilt für frühere vertriebene Gemeindemitglieder aus aller Welt, ihre Nachkommen, frühere Rabbiner, alte Betreuer der Synagoge, Displaced Persons und ihre Kinder (wie die Föhrenwalder Gruppe), aber auch Zuschauer beim Synagogenbrand, alte Nachbarn, neue Anwohner sowie Nutzer eines Trödel-Lagers im Bunker, u.a.m.
Das „Projekt Friedberger Anlage“ ist von daher nicht nur das Werk einer Bürgerinitiative, sondern ein Werk ihrer Besucher. Für manche, die hier gelebt und gebetet hatten, eine Annäherungsmöglichkeit an verlorene Heimat. Unsere Initiative wurde zudem eine Art Andockstelle und erinnerungspolitischer „Verkehrsknoten“ für Frankfurter Bürgerinitiativen, Projekte und Einzelpersonen, die ähnliche Ziele verfolgten.
Auf Drängen der Initiative war es 2002 gelungen, Innenräume des Bunkers anzumieten. Nun konnten diese intensiv für Vorträge, Ausstellungen, Lesungen, Filmabende, Diskussionsveranstaltungen, Symposien u.a.m. genutzt und ausgebaut werden, wie in einem anderen Teil dieser Chronik dargestellt werden soll. Der Ort wurde damit mehr und mehr auch ein Dokumentationszentrum, das dem Lokalen einen weiten Hintergrund gab, aber schwerpunktmäßig die Geschichte des Ortes in der Stadt, insbesondere die hier stattgefundenen Nazi-Verbrechen abzubilden und dazu speziell den Bunker als „Tatwerkzeug“ darzustellen vermochte. Dass dieses entscheidende Ziel bis heute nicht endgültig erreicht ist, liegt daran, dass entscheidende Hinweise – die ausgegrabenen Fundamente der Synagoge – und weitere Forschungen dazu noch fehlen.
1. Zur Aufklärungsmethode – Dokumentieren und Vergegenwärtigen
Die ersten öffentlichen Veranstaltungen in den Bunkerräumen stellten Berichte von Überlebenden der Shoa in den Mittelpunkt. In der Folge kamen kleinere Dokumentationen zu deren Schicksalen, Lesungen aus Autobiografien und entsprechende Filmvorführungen hinzu. Nach längeren Verhandlungen konnten wir eine vom Jüdischen Museum gezeigte Sonderausstellung über das „jüdische Viertel“ des Frankfurter Ostends gewinnen; später erweitert und didaktisch erneuert. Schon mit dieser Ausstellung wurde sehr schnell klar, dass die hier – an einem authentischen Ort – gezeigten Bilder und geschichtlichen Dokumente auf spezielle Weise anregten. Wichtiger als bloßes Zeigen und Erklären war, wie dies von den Besucherinnen und Besuchern innerlich „bearbeitet“ wurde (und wird), wie sich die Wahrnehmung der Inhalte des Präsentierten von klassischen musealen Vermittlungen unterschied. Das war uns wert ausführlich analysiert zu werden. Kam in unserem Vorhaben etwas hinzu, was an diesem Ort, in dieser Umgebung der städtischen Geschichtsvermittlung eine neue Qualität verschaffte, mehr war als „erinnern“? Ließ sich daraus vor allem etwas entnehmen, was politisches Handeln gegen Antisemitismus ermutigte? War hier durch die Arbeit einer Bürgerinitiative eine neue Form der Geschichtsschreibung und Geschichtsvermittlung möglich?
Ich werde zeigen, dass das Rezipieren von Geschichte vom Blickwinkel des Ortes aus betrachtet in mehrfacher Hinsicht andersartig war. Unser Interesse war psycho-archäologischer Natur. Das betraf eine hier wachgerufene veränderte Weise des Nachdenkens als Gruppenprozess (sichtbar v.a. bei Mitgliederversammlungen) , v.a. aber eine offensichtlich starke affektive Beteiligung des Publikums, die regelmäßig nach einer Besichtigung in Gesprächen mit Gruppenmitgliedern zum Ausdruck gebracht werden konnte. Das unterschied unsere Arbeit von musealer, institutionalisierter und akademisch gestalteter Präsentation und Aufklärung. Unserer Überzeugung nach entstand auf diese Weise ein ganz eigenes „Erinnerungsbiotop“, weshalb wir meinen, heute von einer direkten bürgerschaftlichen Geschichtsvermittlung, von einer „Aufklärung und Mobilisierung von unten“ sprechen zu können. Deshalb betrachten wir dieses Vorgehen als prototypisch für eine vorrangig ortsbezogene und ortsabhängige Form der politischen Aufklärung, die aber weit darüber hinaus reicht.
Die Zusammenarbeit mit Überlebenden des Holocaust lässt sich quasi als „Urszene“ unserer Arbeitsmethode auffassen. Dazu suchten wir durch Gespräche in der Gruppe zu erkunden, welches eigene Vorwissen, welche Affekte durch die Erzählungen (re-)aktiviert wurden? Welchen Einfluss hatten die Dokumente und dann auch der Betonbunker auf unsere eigene Rezeption? Mit dem Blick auf das Außen gerichtet stellte sich die Frage, wie die Überlebenden und ihre Berichte die gemeinsamen Veranstaltungen und Dokumentationen im Sinne dieser Wechselwirkung beeinflussten. Ließ sich erkennen, ob der bedrückende Ort sogar rückwirkend die Berichte der Überlebenden in ein neues Licht taucht?
Die Erkundung dieser Fragen erwies sich im Laufe der vielen Jahre bei Gruppenmitgliedern und Besuchern als fruchtbares Verfahren, v.a. was die möglichen Wirkmechanismen einer solchen öffentlichen Aufklärung sein könnten. Vorauszuschicken ist, dass die Klärung dieser Fragen überhaupt nur deshalb möglich war, weil bestimmte Mitglieder über viele Jahre hinweg kontinuierlich in der Gruppe mitarbeiteten. Sie waren auf feste Rollen und professionelle Routinen nicht festgelegt. Keiner war von Beruf Historiker oder Museumswissenschaftler, alle im besten Sinne „Laien“, freiwillig und ausschließlich ehrenamtlich Tätige, die in anderen Berufen arbeiteten oder gearbeitet hatten: Lehrer*innen, Architekt*innen, Ärzt*innen, Psychoanalytiker*innen, Soziolog*innen, Journalist*innen, Schauspieler*innen, Schriftsteller*innen, Filmemacher*innen, Musiker*innen. So konnte sich hier spontan, d.h. „von unten“, aus einer gewissen „erwachsenen“ Erfahrung heraus über eine lange Zeit eine Erkenntnismethode von Geschichte entwickeln, die den Inspirationen, den Erlebnis- und Lernmöglichkeiten zukünftiger Besucher*innen dieses Ortes eher entsprechen sollte, als es in kuratierten und theoriegeleiteten Museums- oder Gedenkstättenprojekten möglich war. Die Gruppe, der im Lauf der 34 Jahre mehr als 100 Mitglieder angehörten, war zu einem „Resonanzkörper“ geworden.
Wir waren in der Lage, eigene Widerstände und „Gedächtnislücken“ stellvertretend für Besucher bei uns selbst erleben und wieder und wieder befragen zu können. In der Folge strebten wir an, dieses Sichselbstbeobachten auch bei unseren Besuchern anzuregen, wenn wir für sie die Ausstellungen im Bunker öffneten und dabei immer begleiteten. Ähnlich wie wir selber berichteten sie v.a. von Mitgefühl, Ergriffenheit, Schreck und Empörung, von eher unwillkürlich aufsteigenden affektiven Reaktionen. Genau genommen ging es dabei um Denk- und Gefühlsvorgänge, die man als „Vergegenwärtigungen“ bezeichnen kann. Das meint nicht so sehr aktives Abrufen, sich vor Augen führen von fertig bereitliegenden Bildern und Gedanken oder um Goethes „Vergangenes-mit-der-Seele-suchen“. Letztlich geht es um halbfreies offenes Assoziieren, um zwar angeregte, aber doch spontane Einfälle. Sie werden vom Leben, den Schicksalen der Überlebenden, ihrer Persönlichkeit, aber auch der Geschichte der Synagogengemeinde, der Zerstörung der Synagoge und den Dokumentinhalten angestoßen. Sie greifen dann auf unsere eigenen Lebensläufe über und beziehen sie mit ein. Aus den äußeren organisierten Hinweisreizen und dem Eigenen entsteht somit ein Erinnerungsmix, der mit Lexikalischem wenig zu tun hat. Das gelingt besonders gut, wenn man die Augen schließt, denn das fördert Freiheit und „Versenkung“ zu einer aufsteigenden Momentaufnahme oder zu Nachbildern, die einem nun vor unbeschäftigte Augen treten.
Man kann auch sagen, dass alles real Wahrgenommene üblicherweise von einem Unterstrom von Gedanken, durch die sogenannten Randgedanken begleitet wird. Diese verbinden sich mit dem Erzählten und Gezeigten. Man mäandert dabei gedanklich zwischen Einzelheiten von Erinnertem, den Randgedanken und aktuell Gehörtem/Gesehenen: ein komplexer Wechselvorgang, der sich grundsätzlich auch nicht genau erfassen und dem einen oder anderen der beiden Stränge erkennbar zuordnen lässt; zumal dieses Zuordnen den Vergegenwärtigungsvorgang selbst stören würde. Nicht selten schweift man auch völlig ab und wird dann irgendwann oder irgendwie wieder „zurückgeholt“. Das kann dann auch längere Zeit nach- und umgearbeitet werden und geht nicht selten sogar in Träume ein (Beradt).
Versucht man die Inhalte des Vergegenwärtigten genauer zu bestimmen, so zeigt sich, dass vieles davon aus mehr oder weniger begrenztem Unglück im eigenen Leben, in eigener Familie und in aktuellen Beziehungen herrührt. Es stammt, wie Heinrich Heine schrieb, aus einem „verwandten Schmerz“. Dies bedeutet nicht, die Differenzen zwischen den eigenen und den fremden Schicksalen zu verwischen oder gar aufzuheben. Dennoch ist es wohl so, dass die aus der eigenen Lebensgeschichte stammenden Affekte und Gefühle sogar das Herzstück für diesen Nachvollzug bilden. Diese stellen die entscheidenden Anreger und die Energiequellen auch für das Mitleid dar, das wir mit ausgegrenzten, deportierten, ermordeten Menschen empfinden und sie quasi in uns „hineinholen“. Nun sehen wir dann den Anderen als jemanden, „der auch ich selber bin“, so Egon Friedell. Was ihm gilt, gilt auch mir. Seine Bedrückung, sein Erschrecken, seine Todesangst sind dann das, was mich erschüttert. Das, was man gewöhnlich auch „Identifizierung mit einem Opfer“ benennt, aber mehr ist.
Im Falle von Mitleiden geht es immer auch um eine regelrechte körperliche Einverleibung von etwas, was andere gleichermaßen körperllich erlebten. Es sind letztlich Schmerzerinnerungen und beide Anteile, die eigenen und die fremden, verbinden sich, ohne sich ganz anzugleichen, ohne ineinander aufzugehen und ihre eigene Herkunft zu verlieren. Fehlt diese Verknüpfung, die Bezugnahme auf ganz Eigenes, bleiben die Menschen kalt und herzlos. (Einzelheiten dazu siehe unten).
Man kann dieses Geschehen auch mit der Traumbildung vergleichen: jeder Traum besteht aus Eigenem und aus Fremdem, was sich am Ende bei seiner Analyse meist noch voneinander isolieren lässt. Letzteres – das Fremde – bezeichnen wir als Tagesreste. Das sind Wahrnehmungssplitter aus den Eindrücken der Vortage (und dazu gehören auch die Reden anderer Menschen, d.h. auch die Überlebendenberichte). Der äußerst bedeutsame Gewinn der zweifachen Herkunft der Wahrnehmungen und Erinnerungen besteht nun darin, dass Fremdes und Eigenes miteinander verfugt wird. Dadurch wird es auf ganz andere Weise in unserem Gedächtnis konsolidiert, besser und tiefer bewahrt und behalten als beispielsweise auswendig Gelerntes. Im weitesten Sinne verstehen wir diesen wichtigen Vorgang als Erforschung von fremder Geschichte im oder anhand des eigenen Selbst. „Ich übertrage vielfach Mitgeteiltes in einen Zusammenhang, den allein ich schaffe“ (Härtling/Hölderlin).
Auch lässt sich dieses Geschehen in einem anderen, scheinbar fernliegenden Zusammenhang wiederfinden: in der kindlichen Rezeption von Märchen, wie es Bettelheim eindrucksvoll herausgearbeitet hat. Märchen erzählen grausamste Geschichten und mobilisieren enorme phantasiebildende Kräfte. Sie wecken Vergegenwärtigungen eigener Geschichte, die die Kinder mit den erzählten Märchenfiguren verbinden, deren Schicksal sie ergänzen und weiterbearbeiten. Dies braucht Zeit zum Nachdenken, zum wiederholten Durchspielen von Lösungen, Konfrontation mit eigenen Affekten. Das befördert psychische Reifung, Wachstum und Selbsterkenntnis. Und das braucht Raum im ganz wörtlichen Sinn und sei es auf dem Sofa neben der Mutter oder dem Vater, wenn sie Märchen vorlesen.
Damit ist Vergegenwärtigung anders zu charakterisieren als das, was man üblicherweise unter Erinnern versteht und das wurde bedeutsam für das spezielle Erinnerungskonzept der Initiative. „Erinnern“ bezieht sich auf Gewesenes, nach rückwärts. Vergegenwärtigung schafft Neues, wirkt nach vorn in die Zukunft, erzeugt im gelungenen Fall Reifung, neue Einstellungen, Handlungsabsichten usw. Das langfristige Engagement von Mitgliedern Gruppe ermöglichte die Beobachtung und Analyse eines normalerweise kaum erfassbaren Geschehens: einen besonderen Gruppenprozess, den unser Mitglied Kurt Grünberg bei seiner Arbeit mit Überlebenden und ihren Nachkommen umfänglich erforscht und beschrieben hat, das „szenische Erinnern“. Auf weitgehend unbewusste Weise reproduzieren sich dabei in Gruppen und Institutionen wie auf einer Projektionsfläche Traumata, Konflikte und Erlebnisse, die sogar „transgenerationell“, also über Generationsschranken hinweg, vermittelt sein und auf dem Schauplatz einer Gruppe ausgetragen werden können. Hier werden sie in Form zunächst unbewusster Gefühlslagen und vor allem in unwillkürlichen Aktionen manifest, ohne dass ihre Herkunft und die Tatsache, dass es sich um Wiederholungen handelt, auf Anhieb kenntlich werden. Damit bot sich der Initiative ein zweites „Mikroskop“, eine neue „Leinwand“, um darauf Geschichte und ein Erinnerungserbe sichtbar werden zu lassen.
Beides ermöglichte allgemeingültigere Antworten dazu, welche erinnerungspsychologischen Prozesse bei diesem „Lernen und Erinnern von Geschichte“ durch – in doppeltem Sinne – „Selbsterwerb“ (durch Einzelerinnerungen und durch szenisches Re-Inszenieren) relevant werden. „Erinnern“ steht also mindestens auf zwei Beinen, verlieh der Erinnerungsarbeit der Initiative methodisch geradezu basisdemokratische Züge. Ihre Arbeit war zwar „laienhaft“, hatte in vielem etwas Unperfektes, Provisorisches, war aber gerade dadurch frei von Anleitung, „erzieherischer“ Pädagogik, von „Erinnerungszwang“. Diese Vorgehensweise löste das Erleben von Geschichte von einem „Nachplappern“ von Daten, die Historiker erarbeitet hatten. Mitglieder und Besucher wurden zu eigenständigen „Geschichtserforschungssubjekten“, die sich zwar auf eine von Fachleuten erarbeitete Ortsgeschichte bezogen, diese aber individuell ausgestalteten und zu eigen machten. Genau das war hier der entscheidende Gewinn, denn alle Professionalisierung, auch alles Supervidieren durch Gruppentherapeuten hätte unserem Projekt ein anderes Gesicht gegeben und andere Wirkungen hervorgerufen. Der gewichtigste Einwand gegen supervidierte Gruppenarbeit ist, dass in solchen Großgruppen „die Fähigkeit stark eingeschränkt wird, Scham, Schuld und Empathie zu empfinden. Der stärker individualisierte Teil ihres Selbst tritt in den Hintergrund. Die Gruppenkultur ist durch zunehmend rigidere Rollen gekennzeichnet…..“ (Friedman).
Dass solche Gruppen allerdings niemals frei von Neid, paranoiden und spalterischen Tendenzen, Macht- und Geltungsbedürfnissen sind, versteht sich von selbst. Bei all dem, was wir machten, was uns antrieb, spielten letztlich bewusste und unbewusste Gefühle, Phantasien und Affekte eine zentrale Rolle. Bei vielen nicht-jüdischen Mitgliedern und Besuchern war es vor allem die Schuldfrage, die gelöst werden wollte und doch nicht konnte. Als ob es uns beruhigen sollte, ist den hier Aktiven zwar immer wieder versichert worden, dass sie keine „Schuld“ im eigentlichen Sinne trügen, lediglich Verantwortung dafür, dass sich so etwas nicht wiederholt. So dachten wir zwar auch, aber die eigene Erfahrung lehrte, dass „Schuldgefühle unausweichlich sind, die man sich nicht ausreden kann und die sich nicht sühnen lassen“. Ein Mitglied sprach von „fortbestehender Restschuld“. Dazu passt, dass das besondere Interesse an der Mitarbeit häufig verbunden war mit einem Bestreben nach externer Absolution oder einem Freispruch durch die Opfer und ihre Nachkommen. War das, was wir machten, also doch ein Versuch der Sühne?
Aus verschiedenen Gründen haben wir diese individuellen und kollektiven Motive (z.B. auch die Schuldfrage) in der Gruppe aber nicht weitergehend untersucht oder gar analysiert. Das kann man kritisieren. Es wurde jedoch vermieden, denn verständlicherweise bestand die Gefahr, dass eine weitere Offenlegung speziell dieser Frage die Gruppe gesprengt und arbeitsunfähig gemacht hätte.
Wenn angesichts des aktuell zunehmenden Antisemitismus immer wieder mehr bürgerschaftliches Engagement eingefordert wird, so hat die Initiative 9. November genau dem in vielfacher Weise entsprochen. Ihre Erfahrungen und Befunde sind als kritische theoretische und praktische Alternativen zur üblichen Erinnerungs- und Gedenkkultur zu verstehen, auch wenn sie bestimmte Tiefendimensionen unseres Engagements nicht erfassen konnte. Die Initiative erzeugte sich, wie im Folgenden weiter ausgeführt wird, eine ganz eigene Gruppen- und Erinnerungskultur, die hinter das Konzept des „kulturellen“ Gedächtnisses ein Fragezeichen setzt.
2. Der Bunkerbau als Gehäuse für Vergegenwärtigungen
Aus einem sehr konkreten Grund unterschied sich unsere die „Erinnerungsarbeit“ von der anderer Erinnerungsprojekte: wir verfügten ab einem bestimmten Zeitpunkt über den 5-stöckigen, noch annähernd originalen Großbunker mitten in Frankfurt. Das hatte außerordentlich vielfältige Folgen. Wir konnten ihn praktisch, gestalterisch und innerlich „besetzen“ und das auch langfristig (wie die Chronik der Initiative beschreibt) vor anderweitigen, z.B. militärischen, kommerziellen und bürokratischen Interessen und Zugriffen schützen. Er war in jeder Hinsicht großräumig, fensterlos, „sperrig“ und kalt mit meterdicken Betonwänden. Es klingt kurios, aber er „schützte“ unsere Arbeit. Er prägte unsere Arbeit und unser Denken weit mehr als wir anfangs gedacht hatten. Allerdings ließ sich erst mit der Anmietung genauer beobachten, was er mit uns und den Besuchern machte oder was er verhinderte, wie er durch seine gegebenen Eigenschaften, aber dann auch durch die von uns gerade hier präsentierten Dokumente und Veranstaltungen usw. unsere Vorstellungen und unser Vorgehen beeinflusste und veränderte.
In der Weitläufigkeit des Inneren konnte hier jeder für sich allein sein, seinen Gefühlen und Assoziationen freier nachgehen und gedanklich mehr „mäandern“; ungestört und in einer gewissen Entrücktheit sich seinem Inneren, seinen Selbstbildern in Verbindung mit Geschichte und Dokumenten eingehender überlassen. Die Ich-Grenzen konnten durchlässiger werden, sich quasi ausdehnen. So fühlte man sich hier nicht besonders „geführt“, angeleitet oder „performed“. Denn in der Nähe zu anderen Besuchern, in geführten Gruppen und kuratierten Ausstellungen folgt das eigene Denken gewöhnlich mehr und mehr einem „common sense“, der von sozial konformeren (Überich-) Forderungen geleitet wird.
Von seinen rohen Betonwänden, schweren Stahltüren, seiner Belüftungstechnik usw. ausgehend bildete der Bunker einen immensen Kontrast für alle Erlebnisgewohnheiten und Routinen (Prousts „habitude“), in die wir Ort, Ortsgeschichte, Dokumente verschiedenster Art immer schnell „eingemeinden“ und d.h. neutralisieren und zum Alltagsdenken zurückkehren lassen. Seine Größe, seine Leere und das Trutzburgartige gaben all dem, was wir hier machten und dachten einen ungewöhnlichen „drive“. Er selbst als Bauwerk war Keil in allen Harmonisierungs- und Gepflogenheitstendenzen und gestaltete Vergegenwärtigungen auf doppelte Weise. Jedes wiederholte Heraustreten aus alten Gewohnheiten wurde auch niemals „Routine“, sondern ereignete sich bei jedem neuen Eintritt in den Bunker immer wieder neu.
Zuerst betraf dies formale Aspekte des Denkens. Seine verschachtelte Binnenarchitektur übertrug sich ganz offenbar auch auf das Muster jener Wege, denen die eigenen Gedanken und Einfälle nachgingen. Insofern wurden Denkabläufe gewissermaßen Nachbildungen des Bauwerkes und das nicht nur in nachteiligem Sinn. Diese folgten – von der Innenarchitektur also zumindest vorgegeben – gleichsam eben jener verwirrenden Architektur von Ausgängen, Treppen, Nebenwegen, die in Nischen und Gelasse des Gebäudeinneren führten. Wie wirksam und einprägend bauliche Gegebenheiten für das Vergegenwärtigen und Erinnern sind, wissen wir seit der Antike; Außen- und v.a. Innenräume treten mit Inhalten, z.B. dort anwesenden Personen und Bildern in eine assoziative Verbindung, die „behalten“ wird. Als Ensemble werden sie so besser in Erinnerung bewahrt und können sich wechselseitig aufrufen (siehe Yates‘ Mnemonik). So „bösartig“ Geschichte und nationalsozialistischer Zweck des Bunkers waren, so prägte er formales Erinnerungsprozedere doch erheblich und schließlich auch die Dynamik in der Gruppe.
Das galt weiterhin auch für inhaltliche Anstöße, die er gab. Was bewirkten seine Panzertüren, die abgewetzten Treppenstufen, der Betonstaub auf dem Boden, die Lüftungsrohre an der Decke, die riesigen Belüftungsmaschinen im Keller, durch die „Kriegsluft“ oder „Friedenluft“ einströmen konnte!? Auf geradezu imperative Weise beeindruckte dabei seine klotzige Gewalttätigkeit, die durch den Umbau in einen ABC-Bunker zusätzlich auch aktuelle Untergangsszenarien wachrief.
Die nicht-jüdischen Deutschen (viele Mitglieder der ersten Phase waren noch in der Nazi-Zeit geboren) konnte er in das Empfinden in Kriegszeiten versetzen und vermochte damit, auch eigene innere Gewalttendenzen, aber v.a. Ängste anzuregen, die man nun eher daraufhin befragen konnte, inwieweit man selbst in der Nazizeit zu antisemitischer Gewalt, zum Mitläufertum oder Unterwürfigkeit hätte neigen können. Er konfrontierte mit der Frage, wie man sich etwa angesichts der brennenden Synagogen 1938, verhalten, tatenlos zugeschaut und später vielleicht von den Juden geraubte Haushaltsgegenstände für billiges Geld erworben hätte.
Das Bunkerinnere weckt natürlich auch Vergegenwärtigungen im Hinblick darauf, was Menschen hier bei ihrem Aufenthalt im Bombenkrieg erlebt und empfunden haben mögen, Vergegenwärtigungsströme, die auch um Verleugnung, Entsetzen und um Rechtfertigungen kreisen. Damit legte er schließlich nahe zu fragen, was davon als Erbe auch in das Engagement in der Initiative eingeflossen sein könnte. In Variationen dürfte er jene milde Angstlust („nazi-cool“) wecken, die Karen Fiss in ihren Untersuchungen und in einem Vortrag bei uns zum gegenwärtig zunehmenden kommerziellen Missbrauch alter Nazi-Bunker dargestellt hat. Zusammengefasst kann man seine Wirkung dadurch beschreiben, dass er etwas Abgründiges hatte, das schwer zu fassen ist, aber auch wegen dessen Unschärfe missbraucht werden kann.
Wenn, wie erwähnt, die Frage nach einer Nutzung des Bunkergebäudes von Teilen der Initiative anfangs mit einem gewissen Widerwillen bedacht worden ist, so wohl v.a. deshalb, weil die bei den Bombenangriffen im Krieg sich offenbarende Gefährdung der Deutschen immer wieder dazu benutzt wurde, eine Gegenrechnung bezüglich der Holocaust-Verbrechen aufzumachen, mindestens im Sinne einer Gleichsetzung von gänzlich verschiedenen Opfern und letztlich also zur Entschuldung der Nazi-Verbrechen. Daraus hat sich eine gewisse Zwiespältigkeit gegenüber dem Ort und seiner Nutzung als Erinnerungs- und Begegnungsort erhalten, eine Ambivalenz, die sich als Widerstand u.a. auch gegen das Ausgraben der Synagogenfundamente äußert.
3. Der Ort als „Zeitzeuge“
Manche Beobachter haben behauptet, dass die Umwandlung des Nazi-Luftschutzbunkers in einen hochmodernen ABC-Bunker 1986, (die mit Zustimmung der Jüdischen Gemeinde erfolgte), dem Ort „das Leben gerettet“ und damit der Initiative ihre nachfolgende Arbeit ermöglicht habe. In Fortführung der Funktion des alten militärischen Bauwerkes im Dienste des totalen Krieges der Nationalsozialisten wurde er damals scheinbar bruchlos für den Kalten Krieg im demokratischen Deutschland wieder nutzbar. Zwar wurden dadurch auch das gesamte restliche Gelände und sein Untergrund mit den Relikten der Synagoge nicht weiter angetastet und diese vor der endgültigen Beseitigung geradezu bewahrt. Zweischneidig war dies jedoch insofern, als er wegen seiner neuen Schutzfunktion von der Initiative bis 2002 nicht genutzt werden durfte. Von kurzen Ausnahmen abgesehen (Ausstellung von Architektur-Vorschlägen einer Stuttgarter Studenten 1996, vergl. erstes Buch der Initiative), blieb er verschlossen, sorgsam von den Nachfolgern jener Frankfurter Feuerwehr behütet, die einst das Abbrennen der Synagoge gewährleistet hatte.
Als ob diese erneuerte militärische Nutzung als ABC-Bunker einen zu augenfälligen „Missbrauch“ des Ortes darstellen, seine Geschichte weiter verbergen würde, wurde im gleichen Jahr 1986 das Gelände vor dem Bunker (im Bereich des alten Eingangshofes der Synagoge), großflächig in ein „richtiges“ Denkmal zur Erinnerung an die zerstörte Synagoge verwandelt. Dieses Denkmal besteht aus einem Gedenkstein (auf dem die Täter ungenannt bleiben), meterhohen schwarzen Granitplatten, Säulen und Grünfläche mit Bänken. Es konserviert Geschichte, sollte den vom Bunker besetzten und gänzlich verdeckten „heiligen Grund“ aber auch insofern integrieren, als es sich an der Bunkerwand in ein senkrechtes Gitter fortsetzt, das bis zu seinem Dachrand reicht und als Rankhilfe dienen soll, für ein Grün, das ihn nun „verschönert“. Dieses bildet mit der Bunkerwand eine Asymptote, die beide auf sinnfällige Weise annähert, im Unendlichen aber nie wirklich miteinander verbindet, unvereinbar sein lässt. Insgesamt erscheint die Denkmal-Anlage eher als ein Grabmal, das mit seinen großen schwarzen Granitplatten einen dunklen Eingang bildet, der zur Betonwand führt und faktisch in eine Sackgasse mündet.
Vermutlich war es auch diese „gut gemeinte“ Verschönerung des Vorplatzes, die Anlass dazu gegeben hatte, dass einige Mitglieder der Initiative am Beginn ihrer Arbeit den bewahrenden Erhalt des intakten Bunkers und ein aufklärendes In-Erinnerung-Rufen der Vorgeschichte des Ortes für miteinander unvereinbar hielten. Zu Recht galt er ihnen als „Kathedrale des Rassismus, Werkzeug der Erinnerungspanzerung, Instrument eines totalen Krieges gegen das internationale Judentum“.
Wie wenig dialektisch das aber gedacht war, wurde bei der weiteren Arbeit am Ort deutlich. Bringt man nämlich den Bunker in einen sichtbaren Zusammenhang mit den zerstörten Resten der Synagoge, dann erwiese er sich gerade nicht als ein durch Begrünung verharmlostes Gebäude, sondern als Tatwaffe, die so wie ein Hammer eine wertvolle Porzellanfigur gerade zertrümmert hat, nun von den Scherben als Trümmerhaufen umgeben ist. So könnte er weh tun und ähnlich dem eindrucksvollen ursprünglichen Trümmer-Mahnmal der Dresdner Frauenkirche, das nach 1989 beseitigt wurde, den „Schutthaufen“ eines Pogrom-Verbrechens zeigen. Deshalb wurde früh die Forderung erhoben, die Fundamente der Synagoge auszugraben, sie in Verbindung mit dem Bunker zu erhalten und dies öffentlich zu zeigen. Das würde beides zukünftig zum wichtigen Stachel oder Menetekel in der Stadtlandschaft machen. Der Ort als Ganzes wird wieder als Tatort erkennbar, der er ist.
Immer regte der Bunker die Frage an, was jene gedacht und gefühlt haben mögen, die ihn im Krieg zu ihrer Rettung aufsuchten. Unweigerlich hatten sie noch die Asche der verbrannten Synagoge an ihren Schuhen, die hier bis heute die Erde durchmischt. Konnten sie überhaupt ignorieren, was sie zuvor angerichtet hatten und was dann nach Auschwitz führte, wo zur gleichen Zeit an eben jenen, denen dieser Ort einmal heilig gewesen war, genau das exekutiert wurde, vor dem diese gerade bewahrt blieben: Ersticken und Verbrennen? Saßen sie nun nicht genau in dem Feuer, was sie selbst hier gelegt hatten? Und hat dies das Mitgefühl mit den von hier vertriebenen und später ermordeten jüdischen Nachbarn beeinflusst? Oder erzeugten die Verhältnisse hier bei Bombenangriffen eher besondere psychische Ausnahmezustände, sog. „altered states of consciousness“, die zu einer kompletten Abkapselung von Erinnerungen und realer Schuld führten und alle Phantasien und Ängste ganz auf die seinerzeit aktuelle Umwelt im Bunker und in der Stadt richteten, auf die heftig spürbaren Erschütterungen, das Donnern der Bombeneinschläge und die naheliegende Möglichkeit, dass ihre Häuser und Wohnungen just in diesem Moment abbrannten? Was also haben die Menschen hier gefühlt, was gedacht und was klang z.B. im Jahre 1944 vom 9. November 1938 noch nach, weil es in den Betonmauern regelrecht gespeichert worden sein könnte? Diese Frage kann man stellen und beantworten.
Dass ein Bunker und gerade dieser über ein Erinnerungsvermögen verfügt, dass er sich grundsätzlich auch etwas „merken“, noch wichtiger: dass er zu einem „Zeitzeugen“ verschiedenster Epochen werden kann, dieses Vermögen zur Abwandelung seiner Bedeutungen und Funktionen kann man heute noch daran belegen, was ihm durch Maßnahmen unserer Initiative eingeschrieben wurde, (so wie er bereits auch vom „Kalten Krieg“ erzählt, als er zum ABC-Schutzbunker umgebaut wurde).
Die „Einschreibungen“ kamen durch das zustande, was die Initiative hier aktiv machte und in Szene setzte. Zuerst und am wichtigsten waren es die erwähnten Veranstaltungen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Holocaust. Von ihrem Auftreten und ihren Berichten gingen Wirkungen aus, die die Zuhörerinnen und Zuhörer außerordentlich berührten und auch veränderten. Indem jene von ihren schweren Schicksalen berichteten, wurde der Bunker Erzählort in einer tieferen Bedeutung, alles andere als ein neutraler Hintergrund. Vielmehr „ergänzte“ er Berichte und Dokumente und machte Verfolgungsgeschichten wirklichkeitsnäher und gegenwärtiger. Er stellte diese gewissermaßen vor Betonmauern und Lüftungsanlagen und grundierte die Lebensgeschichten, ebenso wie die von uns gezeigten Bilder, Filme und Dokumente der Verfolgung durch sichtbar gemachte historische Gewalt. Gerade daran zeigte sich, wie der Ort sich zu dem entwickelte, was die Initiative von Anfang an beabsichtigt hatte: dass Bunker und Ort kein Museum oder bloß Mahnmal, nicht nur Gedenkstätte sein sollte, sondern Interpret oder „Koreferent“ der in ihm dokumentierten Inhalte. Der Bunker wurde ein Palimpsest (wie alte Papyrus-Schriften neu überschrieben).Sein Erscheinungsbild und seine psychische Wirkung waren dadurch verändert, „neu überschrieben“ und zu einem Gegenwarts-Gedächtnis geworden, das das alte Gedächtnis allerdings wie ein Wasserzeichen immer noch erkennen ließ. Damit hörte er auf, was machen mutmaßen, allein Nazi-Monstrum, ein „reines Luftschutz“-Gebäude zu sein. In dem Überschriebenen lebte und lebt nun auch vieles von den Zeitzeugen fort; seine alte und neu geschaffene beunruhigende „Abgründigkeit“ hat er bis heute behalten.
Wie bedeutsam diese Eigenschaft u.E. für alle Gedenkstättentheorien (vergl. dazu Huyssens „Twilight Memories“) ist, wurde deutlich, als die Zeit der Zeitzeugenschaften mehr und mehr zu Ende ging. Das durch die Überlebenden und unsere Arbeit „inkubierte“ Neugedächtnis erweist sich in gewisser Weise nun als autonom und bleibend. Hatten die Zeugen den Ort durch ihre Berichte maßgeblich verändert, so wirken ihre Inschriften nun für sich, also nicht mehr durch die anwesende Person der Zeitgeschichte, sondern mehr und mehr so, als ob sie den Beton wie Bildhauer bearbeitet hatten und in ihm ihre Spuren für immer hinterlassen haben.
Dabei wurden auch die aktiv tätigen Mitglieder der Initiative mehr und mehr zu so etwas wie Ersatz-Zeitzeugen oder zumindest Mittlern, die das von den Zeitzeugen Inkubierte „weiter sprechen machten“. Durch diese Einschreibungen neuer Wirkungen wurde der Ort selbst ein vieldeutiges Gedächtniskontrukt, die Initiative dessen „Bildhauer“. Natürlich ist dieses „Gedächtnis“ nicht autonom, Steine haben keine neuronalen Speicher. Seine Kontrukteure schafften eine neue sichtbare, ertastbare Gestalt, die die ursprüngliche Erscheinung veränderten, Neu-Gedächtnis wurden, ohne selbst immer sichtbar zu sein, so wie Trampelpfade im Gras auf nicht mehr anwesende Menschen schließen lassen.
An diesem Geschehen muss sich das messen und definieren lassen, was heute gerne mit dem Begriff des „kollektiven Gedächtnisses“ normiert und simplifiziert wird, das – wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden will – niemals unabhängig von subjektivem Wissen und höchst persönlichen hinzugefügten Vergegenwärtigungen gedacht werden kann. Stets sind diese Gedächtnisspuren an weiteres menschliches Wissen, Vergegenwärtigungen und Interpretationen, also an Erzählungen von „Ersatzzeitzeugen“ gebunden, und können deswegen leicht verloren gehen. Um wirklich dauerhaft zu bleiben, fehlt ihnen bis heute die endgültige steinerne Bestätigung durch die Synagogenfundamente.
4. Der virtuelle Untergrund des Ortes
Sie überraschen, ja sie erschrecken immer wieder, vor allem deshalb, weil sie für Sekundenbruchteile mit Lebenden verwechselt werden, die als Phantasma hier bereits vorhanden waren. Sie erschrecken v.a. durch ihre unerwartete Wiederauferstehung und ihre Lebendigkeit. Sie erschrecken als „revenants“, die – aus dem Untergrund der Synagogenfundamente zurückkehrend – sich unter die Dokumente und realen Besucher mischen. Besucher und Figurinen, Dokumente und Bunker bilden so eine lebendige Szene, bis man sich über den „Irrtum“ der Verlebendigung klar wird. Sie ernten den Wirklichkeitssinn des Traumes, sind eine Darstellung, die in ihrer Einmaligkeit und „Bodenlosigkeit“ wohl nur im Bunker in der Friedberger Anlage in Frankfurt möglich war und ist.
Um deren Bedeutung sinnbildlich zu beschreiben, fanden wir das Bild vom „Transfer aus dem Untergrund“. Einige verglichen es auch mit einer „radioaktiven Strahlung“, die von der im Untergrund des Bunkers vergrabenen Geschichte ausgehe. Natürlich war dies nicht zu objektivieren, konnte dennoch irgendwie geahnt und nicht mehr einfach vergessen werden. Immer wurden die Synagogenfundamente weiter als existent geahnt. Als ob sie ihre Ahnung auch nicht täuscht, bestätigten nicht wenige jüdische Besucher das dadurch, dass sie beim Betreten des Bunkers ihre Kipa aufsetzten. Bei anderen zeigten sich die persönlichen „Wurzeln“ ihrer Herkunft, wenn sie den Bunker Englisch redend betraten, um beim Verlassen Frankfurter Dialekt zu sprechen.
Ohne so recht das Geheimnis ihres Tuns zu begreifen, hatte die Initiative dies ähnlich einem Diorama bildlich dargestellt: eine großartige Idee der ersten Ostendausstellung aufgreifend hatten wir zwischen alle weiteren Ausstellungen in den verschiedenen Etagen metergroße Fotografien einzelner Personen aufgestellt. Diese waren aus Fotoaufnahmen jüdischer Menschen aus den 20er Jahren ausgeschnitten und auf frei aufstellbare Holzplatten aufgezogen worden. Wer heute den Bunker betritt, sieht also z.B. am Ende eines langen dunklen Ganges Figurinen in Menschengröße.

Auch daran zeigte sich, wie der Ort immer mehr dem entsprach, was wir von Anfang an beabsichtigt hatten: nicht bloß ein Mahnmal oder eine Gedenkstätte zu schaffen, die eine besondere Geschichte ersatzweise abbilden. Wenn diesbezüglich – wie häufig geschehen – überhaupt von einem „Museum“ gesprochen werden kann, dann von einem „Museum von unten“, das nun aber nicht nur von Frankfurter Bürgern „von unten“ aufgebaut worden ist, sondern etwas mit einbezog, das tatsächlich aus dem Untergrund stammte, real durch die Synagogensteine und virtuell durch die „revenants“. Am Ort des Verbrechens an der Friedberger Anlage konnte der Untergrund von 1938 wirklich „lebendig“ werden.
Besonders durch seine Kälte und Rohheit, dann durch seine frühere Funktion als Luftschutzbunker, der zum angeblichen Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen 1986 nochmals umgebaut worden war, erhielten die Ausstellungen eine eigenartig unvertraute, d.h. alt-neuartige Wirkung. Alles Gezeigte erschien in einem fremden, beinahe unheimlichen Licht, so wie auch die Berichte der Zeitzeugenintensiver„grundiert“ worden waren.
Das spezifische Geschichtserleben im Bunker tritt noch deutlicher hervor, wenn man es mit jenem klassischer Museen vergleicht. Da unsere Ausstellungen zumeist Dauerausstellungen waren und sind, behielten alle Exponate beständig ihren Platz; man konnte und kann dieselben Bilder immer wieder aufsuchen und ihnen wiederholt „nachhängen“ und Neues entdecken. Präsentationen in Museen sind gewöhnlich zeitlich befristet. Das ist unumgänglich, weil Museen auf hohe Besucherzahlen angewiesen sind [i]und Leihgaben alsbald zurückgegeben werden müssen. Ihre Räumlichkeiten haben etwas von leeren Schaufenstern. Sie sind zumeist eine Wechselbühne, gut für Vorführungen austauschbarer Vergangenheiten. Museen zeigen von Fachwissenschaftlern zusammengetragene und „betreute“ Dokumente, die Unkundigen etwas vorzeigen, die als Belehrte in einer eher passiv-rezeptiven Position gehalten werden.
5. Der reale Untergrund des Ortes
Wenn man das, was die Initiative hervorbrachte, als „Treibsand der Erinnerung“ bezeichnen würde, so hätte das vielleicht deshalb eine gewisse Berechtigung, weil dieser Ort Jahrzehnte lang seine realen „Wundmale“ verborgen gemacht hatte, sie leicht verborgen und trotz unserer Arbeit vergessen werden konnten. Um dem etwas entgegen zu setzen, nicht endlos warten zu müssen und die realen Reste der Synagoge real zu belegen, begannen Mitglieder der Initiative – gegen entschiedenen Widerstand mancher Denkmalschützer – im hinteren Außenbereich des Bunkers nach realen Spuren der Synagoge zu suchen und v.a. danach zu graben.

Sehr rasch stießen wir dabei auf Mauerreste, Ziegel, Kacheln und Teile von Fundamenten. Was sie zu sagen hatten, unterschied sie auf bemerkenswerte Weise von den Dokumenten unserer Ausstellungen. Sie erregten Affektives, wie es Fotografien, schriftliche Berichte, Statistiken kaum vermochten. Weniges hat uns z.B. mehr erschüttert als eine hier aufgefundene, mehrere Millimeter dicke Glasscherbe, die teilweise geschmolzen und rauchgeschwärzt war. Sie stammte ganz offensichtlich von einem Synagogenfensterglas, das im Brand teilweise verflüssigt worden war. Es war ein Relikt, das die Vergangenheit in die Gegenwart holte, eine Zeitkapsel. Vergleichbar der berühmten Armbanduhr aus Hiroshima hatte es die Stunden des alles zerstörenden Synagogenbrandes konserviert. Es wirkte fast so, als wäre das Glas noch heiß. Solche Funde erschüttern, sie „sprechen lauter“ und unmittelbarer unsere Sinne an als Filme und Dokumente. Es entsteht der Eindruck, dass unter den Brandresten der Synagoge das Feuer jenes Pogroms weiter „glüht“.
Solche Funde sind erschütternd, weil sie als Relikte vernichteter menschlicher Körper empfunden werden können. Sie tragen diese in sich, so wie man es von Grabsteinen behauptet. In dem Moment, als der Täter von Halle in die Synagogentür schoss, standen unmittelbar dahinter Menschen, die um ihr Leben fürchteten; alles hing an einem seidenen Faden bzw. dieser Tür. Er wollte die Menschen treffen. Das erschüttert uns, weil wir sie und uns in eins mit der Tür setzen.
Die Trümmer der Synagoge in der Friedberger Anlage erschrecken, weil sich auch in ihnen sichtbar und fühlbar jene mörderische Gewalt, der ganze Wahn verdichtet haben, den die Täter in den Brand und das Zerkleinern des Gebäudes hineinlegten. All das sind Hass- und Paranoia-Effekte. Sie wollten in den Mauern Menschen treffen, die sie in sie hineingelegt hatten. Steintrümmer können als Revenants ermordeter Jüdinnen und Juden gelten. Nichts von dieser Hemmungslosigkeit könnten Fotografien, Mahntafeln etwa an einer wieder aufgebauten Synagoge oder einer neuen Begegnungsstätte zum Ausdruck bringen.
Die Funde bei unseren Probegrabungen waren Anstoß dafür, dass eine professionelle Grabungsfirma zusammen mit einer Frankfurter Schulklasse weitergehende Stichgrabungen durchführte. Dabei wurde die Existenz von Synagogenfundamenten endgültig belegt und Hinweise darauf gefunden, dass hier möglicherweise noch Kellerräume existieren. Das bestätigte und rechtfertigte endgültig das, was die Gründungsmitglieder der Initiative 1988 dazu gebracht hatte, diesen Ort auszuwählen, um ihn zu dem zu machen, was sich bestätigt hat – Dokument und Mahnmal eines Tatortes. Das macht die Fundamente der Synagoge eben auch zu den Fundamenten der Initiative.

Mit diesen Ausgrabungen änderte sich der Erinnerungswert des Ortes grundlegend. Endgültig musste es nun um mehr gehen als eine „imaginäre psychische Wirkung“, die genauso gut durch ein aus Betonklötzen zusammengesetztes, künstlich geschaffenes Mahnmal wie das zentrale Mahnmal in Berlin zustande kommen könnte. Unsere Steinfunde waren „echt“ und damit etwas völlig anderes, nämlich Hinweisreize, von denen man mit Recht behaupten kann, dass sie reden oder sprechen oder – wie eingangs erwähnt – überwältigen können. Das ist wörtlich zu nehmen. Es meint keine bloß gedanklich hineingelegte Zutat, keine bloßen aus dem Geschichtswissen stammenden Zuschreibungen. Es geht nicht um anthropomorphes Denken, nicht um Animismus. Vielmehr kommt etwas aus ihnen selbst, weil sie in einem geschichtlich entscheidenden Moment von Menschen durch Gebrauchsspuren materiell verändert worden sind. Menschen, Täter und Opfer, haben ihre Körperabdrücke, die mechanische Wirkung ihrer Werkzeuge und ihre Gefühle in ihnen hinterlassen, indem sie zuerst die Synagoge durch bearbeitete Steine zusammengebaut hatten, Stein auf Stein gesetzt und zu einem Sakralbau verbunden wurden. Dann haben die Zerstörer voller Kälte und paranoider Wut das Zusammengefügte in kleine Teile zertrümmert, zu Asche gemacht und irgendwo verstreut.
Die Steine der Synagoge sind deshalb zwar nicht unmittelbar Tonträger von Reden etwa wie Schallplatten. Aber wie Fingerabdrücke auf einem Mordwerkzeug haben sie die Spuren als Wundmale sicht- und tastbar bewahrt, Wunden, in die man seine Finger legen kann. Das berührt. Das verleiht den Steinen endgültig und ganz unmittelbar Sinnesqualität, wie Blindenschrift auch tatsächlich die Eigenschaft eines originalen historischen Beweismittels. Sie sind durch diese extrem gegensätzlichen Handlungen, Aufbau und Zerstörung geformt und geprägt. Das vermag kein nachträglich nach einer Tat errichteter Gedenkstein, kein Museum, kein Memorial. Das gilt auch für eine wieder neu aufgebaute Synagoge. Sie würde den geschichtstouristischen Blick auf das richten, was ist und nicht auf das, was war, auf ein Imitat, einen Retro-Bau, der an jeder x-beliebigen errichtet werden könnte, auf Geschichte ohne Vergangenheit. (Groebner, S. 126).
6. Der Ort weckt körperliche Urformen des Erinnerns
Die verschiedenen genannten emotionalen Reaktionen lenkten dann den Blick erneut zu der Frage, welche Bedeutung sie für das Erinnern und die Mobilisierung einer Bereitschaft haben, sich im Kampf gegen Antisemitismus zu engagieren. Deutlicher als früher wurde klar, welch große Bedeutung dabei dem Erschrecken zukommt. Erschrecken ist nicht allein ein emotionales, sondern auch ein körperliches Ereignis. Die Aufforderung, Geschichte zu „erinnern“, in Erinnerung zu bringen, ist von daher kein hinreichend wirksames Mittel der politischen Aufklärung. Diese braucht Erlebnisse speziell affektiv-leiblicher Natur. Treffend charakterisiert wird dies, wenn man heute zu den Einschüssen in die Synagogentür von Halle sagt, sie gingen „ins Herz“. Das ist mehr als ein sinnbildlicher Vergleich. Dieser Satz ist wörtlich zu nehmen. Es geht um Erlebensweisen, die sich vorrangig sogar im Inneren des Leibes ereignen. Wie im Zusammenhang mit dem Schreckaffekt gezeigt werden wird, ist anzunehmen, dass dabei frühkindliche Formen des Erlebens beteiligt sind, d.h. mit Anteilen kehrt man beim Erschrecken in einen quasi frühkindlich-schutzlosen Zustand zurück, der eine klare Trennung zwischen eigenem und fremdem „Leib“ nicht kennt. Es reagiert und spricht dann der ungeschützte sprachlose Körper.
Von solch frühesten Wahrnehmungsweisen wissen wir v.a. durch die Untersuchungen der Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker von Kleinstkindern. Danach wird dieser Erlebensmodus in der frühesten nachgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung begründet. Das geht mit einer besonderen Disposition für Traumatisierungen einher oder anders gesagt: Traumatisierungen greifen auf diesen Erlebnistyp zurück. Es geht um Leiden – im Leben das erste überhaupt – um Hunger, Verzweiflung und Todesangst (Klein). Auch dies wird zur Grundlage des „verwandten Schmerzes“ Heines, der beim Mitleiden aktiviert wird. Damit ist dann auch eine weitere Quelle des Mitleids angegeben.
Das Mitleiden könnte einen Impuls zum Handeln vom sogenannten Moro-Reflex geerntet haben, den Rothe als „Erschütterungsphänomen“ bezeichnet hat. Die seelische Verfassung des Mitleidens ließe sich dann sogar mit neurophysiologischen Vorgängen in Beziehung bringen, den Schock selbst, die ersten Erscheinungen des Schreckaffektes mit einem Blitzschlag vergleichen. Vielleicht kann man diesen Reflex von Säuglingen als Prototyp des Schrecks verstehen. Hier lässt er sich willkürlich über etwa die ersten vier Monate nach der Geburt auslösen und zwar durch einen Schlag auf die Unterlage oder durch einen Knall oder durch Rückwärtsbeugung seines Oberkörpers.
Dieser Reflex lässt sich sowohl als Schutz- wie als Fluchtbewegung deuten: ein blitzartiges Zusammenzucken des gesamten Körpers wird ergänzt von einer Aktivität der Arme, bei der der Säugling diese ausbreitet, um sie anschließend vor der Brust zusammenzuziehen, was man als Vorform einer schutzsuchenden Gegenbewegung gedeutet hat. Was wie eine Ohnmacht beginnt, wird nachfolgend von einer „hoffnungsvollen“ Bewegung abgelöst, einer Schutzsuche als Abwehrbewegung des Schrecks. Immer wieder hat man den Reflex daher mit der Fluchtreaktion, dem „Aufspringen“ einer Heuschrecke verglichen und beide eben auch sprachlich miteinander gleichgesetzt. Den Reflex selbst kann man etwa ab dem 4. Lebensmonat nicht mehr auslösen, aber die von ihm gebahnten psycho-somatischen Wege bleiben – so diese These – erhalten und lebe werden in späteren Schockzuständen reaktiviert.
Aufgrund ihrer Arbeit mit Koma-Patienten lassen Untersuchungen der Freiburger Traumaforscher Sauer und Emmerich sogar vermuten, dass dieser Erlebnistyp einer körperlichen Verbindung auf einer noch früheren, nämlich intrauterinen, also vorgeburtlichen Organismus-Umwelt-Beziehung aufbaut, d.h. einer eher grenzenlosen organischen Verbindung von Mutterleib und Fetus, in der der Moro-Reflex noch nicht nachweisbar ist.
Während manche Besucher das Bunkerinnere mit seiner räumlichen Nähe zu den Synagogenresten wie eine Grabkammer erlebten, (dazu trug auch das Denkmal vor dem Bunker bei, das wie ein blockierter Zugang zu einer Krypta oder Unterwelt gedeutet werden kann), führte es bei anderen zu einem Körpererleben, das den Bunker wie eine gebärmutterähnliche Hülle erleben ließ und nun auf spezifische Weise äußerst empfindlich machte, irritierte und kränkte (!). Es geht dann um eine besondere Anfälligkeit für Schutzlosigkeit und Angst. Dazu mag selbst Physikalisches beigetragen haben, das die Körperempfindungen veränderte: denn die Innentemperatur des Bunkers wich immer deutlich von der Außentemperatur ab. Seine außerordentlich dicken Betonwände machten ihn zu einem Speicher für die Temperatur vergangener Jahreszeiten. Im Frühjahr war er regelmäßig eiskalt, im Sommer kühl, im Herbst warm. Auch Geruch und Raumklang waren und sind verändert. Die sich hier manifestierende immense Gewalttätigkeit bedrückte nicht nur. Nicht wenige Mitglieder der Gruppe berichteten davon, dass sie sich nach einem Bunkerbesuch wiederholt tatsächlich krank gefühlt haben.
So lässt sich vermuten, dass es auch die Atmosphäre im Bunker war, die dazu führte, dass hier aktvierte Eindrücke ein ganz frühes Erleben mobilisieren, eine „diaplazentare“ Wahrnehmung anregen, bei der Reize durch die Plazenta hindurch in den ganzen menschlichen Körper eindringen, eben auch „ins Herz“, was tendenziell eine Ahnung oder sogar Androhung des Unterganges des eigenen Körpers und gleichzeitig der äußeren Welt und anderer Körper vermitteln kann. Deswegen hat Heine doch nicht ganz recht, wenn er meint, dass jeder eigentlich nur für sich selbst weint. Der andere in uns weint auch. Dabei verbindet sich unser Ich mit dem von Anderen, denen etwas zugefügt worden ist.
Das ergänzt die Behauptung, dass es nicht „einfaches Erinnern“ ist, was Entsetzen über die früheren Nazi-Verbrechen provoziert. Schon gar nicht bewahrt es vor verbrecherischen Wiederholungen. Im Gegenteil: der Täter von Halle hat gerade sehr gut „erinnert“; er hatte, wie sein Computer auswies, alles „parat“, was sich 1938 abgespielt hatte und suchte es auf ähnliche Weise zu wiederholen. Alles war bei ihm offenbar auch innerlich gespeichert, wie vererbt, geprägt von dem alten Hass, der Paranoia, Wahngewissheit, dem Vernichtungswillen und der Gewaltbereitschaft gegenüber der Synagoge und ihren Gemeindemitgliedern. D.h. der Pogrom 1938 existiert als Handlungsvorlage gerade unter Rechtsradikalen weiter und wird insofern auch „erinnert“. Die Tat in Halle war ein Remake und zielte auf basale Bedrohung und Erschütterung. Wiedergänger wollen immer wieder Schrecken, seelische und körperliche Vernichtung erzeugen.
Man kommt also nicht daran vorbei zu behaupten, dass solche antisemitischen Verbrechen aus Überlieferungen und ebenfalls aus einem bestimmten Typ von „Erinnern“ hervorgegangen sind. Erinnern per se ist nicht im mindesten die Rettung, nicht die „Erlösung“. Erst deren nachfolgende „Bearbeitungen“ sind für alles Weitere entscheidend. Alles hängt davon ab, welche Affekte im Spiel sind und inwieweit Spaltungen und Feindbild-Projektionen dabei eine Rolle spielen oder nicht. Nazitäter löschen bei sich (außer vielleicht in Bezug auf Schäferhunde) alles Mitgefühl aus und diffamieren oder bekämpfen ein solches auch bei anderen Menschen. Zu ihren Feinden kappen sie jegliche menschliche Verbindung, jeden identifikatorischen Bezug, jede innere Nähe zu anderen, jede Einverleibung. So verschaffen sie sich Unerreichbarkeit, Machtgefühl, Grandiosität und sind für alles Erschüttertsein, alles Mitleiden letztlich auch mit sich selber verloren. Mitleidlosigkeit und Mordlust werden ermöglicht durch Projektion und Spaltung.

Nicht so bei Menschen, die sich die Fähigkeit zu Mitgefühl bewahrt haben und sich Spaltungs- und Projektionstendenzen versagen. Weil das aber gar nicht so leicht ist, auch die Mitleidenden die innere Beziehung zu Opfern immer wieder abschwächen, sich dran gewöhnen, ist es notwendig, das Erschreckende immer wieder zu zeigen. Das hat die jüdische Gemeinde Halle verstanden, als sie dauerhaft als mahnendes Erinnern die zerschossene Tür sichtbar gemacht hat. Sie bringt uns dazu, dass wir uns immer wieder innerlich hinter diese Tür stellen und so körperlich in uns vergegenwärtigen können, was die Menschen im Moment des Anschlags empfunden haben mögen. Dass die Tür „redet“, ist wörtlich zu nehmen. Diese Wirkung verleiht den Steinen der Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft ihre besondere Aussagekraft (gerade weil die Synagogensteine am Börneplatz beseitigt wurden) und begründet das entscheidende Verlangen der Initiative, die Fundamente an der Friedberger Anlage endlich auszugraben und öffentlich zu zeigen.
7. Erschrecken als Erreger politischen Handelns
Es zählt zu den menschlichsten Reaktionen, Unglück, Schmerz, Krankheit, Zerstörung und Tod aufhalten und dagegen einzuschreiten zu wollen. Dieser Antrieb stand und steht sicherlich auch hinter den Motiven, sich in der Initiative 9. November zu engagieren. Es ging darum, zu verstehen und zukünftig zu verhindern, was vor und während der Nazizeit an dem Tatort des Pogroms von 1938 vorgefallen war.
Niemand aus unserer Gruppe und von unseren Besuchern wird daran zweifeln, dass die Wirkung dieses Ortes und unser Engagement letzten Endes vom Entsetzen lebt. Am Anfang steht also ein Schock. So wie ein Vulkan ausbrechen und eine Landschaft umgestalten kann, verfügt auch ein solcher Schock über genügend Kraft, um unser Engagement einigermaßen lebendig zu halten. Alle innere Bewegung, die aufklärend und handlungsanregend wirken soll, kann nur in Verbindung mit einer emotionalen Annäherung an den Horror erfolgen. So jedenfalls deuten wir selbst die scheinbar belanglose Tatsache, dass wir selbst und unsere Besucher das Bunkerinnere, bei welcher Gelegenheit auch immer und gleichgültig mit welchem Ziel, ständig mit einer gewissen Beklemmung betraten, den man als mildeste Form von Schock und Angst verstehen kann.
Was charakterisiert diesen Schock? Als erste Vorbedingung für seine Bildung braucht es einen besonderen Erlebenszustand der Nachdenklichkeit und Dünnhäutigkeit, ja der Trance, die der Bunker begünstigt. Die Bunkerräume zusammen mit den stark kontrastierenden Dokumentationen, Veranstaltungen, Konzerten versetzen viele Menschen in einen gewissen Ausnahmezustand, reduzierten nüchternes Alltagsdenken und regen so – anders formuliert – alternative Wahrnehmungszustände an. In diese brechen Ängste und vor allem dann aktivierte Horrorvorstellungen ein. Ins Wahrnehmungspsychologische übertragen heißt das: dann sieht sich das Ich mit Schreckereignissen konfrontiert, steht es zuerst körperlich überwältigt und entmachtet da. Wie Landauer postuliert hat, kann dies dann einen Prozess herbeiführen, der den Schreck in Angst verwandelt und so einen weiteren Kontrollverlust aufhält oder verhindert. „So fällt der Angst die Funktion der Schreckvermeidung zu. Oder genauer: es soll die Wiederholung eines Schreckens verhindert werden, der schon einmal gewesen ist und der die Angst in ihre zweifelhafte und zwielichtige Existenz eingesetzt hat, Abkömmling des Schreckens zu sein und vor ihm zu schützen“, wie Dietmar Becker erläutert. Das nun beinhaltet eine Überführung des Schrecks in eine Leistung des reiferen Ichs, denn schon die nicht mehr bloß „nackte“ Angst ist seine „Erfindung“, selbst eine aktive Leistung unseres Ichs, weil sie Schutz- und Hilflosigkeit in den Griff zu bekommen sucht, was ihr – wenn auch oft noch unvollkommen – gelingen kann. In Angst verwandelter Schreck wird zum Alarmsignal, das nach Rettung Ausschau hält. Und das führt ins Politische und zur Frage des politischen Handelns. Das beinhaltet die Möglichkeit ihrer zunehmenden Milderung: gemilderte und dann überwundene Angst wird nun „Schwelle zum Tatendrang“ (Sauer).
Wieder kann man sich, um das verständlicher zu machen, an die Märchen halten: auch sie lassen einer mentalen Erschütterung Rettung folgen. D.h. was als höchst beunruhigender körperlicher Schock beginnt, als traumatischer Moment bis hin zu tödlicher Angst und Starre, in dem sich die Ich-Grenzen auflösen, das führt das Märchen zu harmloseren Lösungen, macht aus einer Todesandrohung etwa im Märchen von Dornröschen eine hundert Jahre währende Körperstarre, sprich unweckbaren Schlaf. Die gutartige 13. Fee steht für schützende Personen und ein Ich des Kindes, das nach rettenden Lösungen suchen kann, (aufbauend auf dem erwähnten zweiten Reflexanteil des Moro-Reflexes, bei der der Säugling seine Arme vor sich verschränkt, wie um sich nun selber dahinter zu schützen oder durch Anklammern Schutz zu suchen).
Ebenfalls durch Bearbeitung des Ichs kann daraus schließlich ein Handlungsdrang, ein Bemächtigungstrieb entstehen, der darauf zielt, in der Realität Vergleichbares nicht mehr zuzulassen und nach Abwehrstrategien zu suchen. Zu Erschrecken und Bedrohung gehört also, dass sie neben Hilflosigkeit und Mitgefühl und Rettungsphantasien dann immer auch Eigensinnigkeit, Trotz und Wutphantasien anregen, affektgeladene motorische Gegenbildungen gegen das „Unterworfensein“, um so die Überwältigung aufhalten oder ungeschehen zu machen. D.h. das Ich ist in der Lage, Problemlösungsstrategien und eine vorausschauende Moral zu entwickeln, die darauf abzielt, Schrecksituationen nicht mehr nur in der Seele, sondern auch in der Außenwelt zu vermeiden. Das wäre – kurz gesagt – das psychologische Programm der Initiative 9. November gewesen, auf das sie sich zu stützen suchte. Sie wollte und will Schreckliches zeigen, zu Aktivität anregen, um es zukünftig zu verhindern. Das war und ist die hier angestrebte emotionale und soziale Erfahrung, die wir vermitteln wollten. Um einem Motto von Nietzsche zu folgen musste der Satz gelten: Nur was nicht aufhört zu erschrecken, rettet vor Wiederholungen.
Schluss
Abschließend ist festzuhalten, dass es seit 1988 an dem Ort Friedberger Anlage 5 einer Bürgerinitiative gelungen ist, mitten in Frankfurt die deutschen Pogrom-Verbrechen vom November 1938 öffentlich als Tatortgeschehen sichtbar zu machen. Organisation, Vorgehen und Ziele der Initiative unterschieden sich von Anfang an von jenem von Fachwissenschaftlern und berufsmäßig tätigen Historikern, die gerade auch diesen Ort und seine Geschichte ignoriert haben. Seit 1988 hat sie durch ihre Arbeitsweise und ihr ganz konkretes, kämpferisches, praktisches und handwerkliches Engagement in Bezug auf ein historisch belastetes Grundstück der Stadt Frankfurt die spezielle Bedeutung und Wirkung bürgerschaftlichen Handelns aufzeigen können: Herausarbeitung, Dokumentierung und öffentlichen Darstellung eines vergessenen oder ignorierten Tatortes als Werk von freiwillig tätigen, nicht-professionellen Laien.
Außen- und Innenbereich des Bunkers bilden heute ein von ihnen geschaffenes Dokumentations- und Versammlungszentrum, in dem die mit diesem Ort verbundenen Folgen der Vertreibung und Zerstörung einer bedeutenden jüdischen Gemeinde und ihrer prächtigen Synagoge in seinem umfassenden Kontext dargestellt werden. Der Ort wurde über die Jahre auch zu einer Begegnungsstätte für viele tausend Besucher aus dem In- und Ausland, insbesondere für die Überlebenden und ihre Nachkommen.
Unsere Gruppe selbst wurde gegründet, gemeinsam und kontinuierlich getragen von einer Gruppe von jüdischen und nicht-jüdischen Frankfurtern der zweiten Generation, deren Doppelung sich in gewisser Weise auch baulich in einem Doppel der Monumente – Synagoge und Bunker – spiegelte. Zusammen einte sie die Vorstellung, dass gerade die Darstellung von Zerstörtem in Verbindung mit Zerstörendem das Erschrecken über die Nazi-Verbrechen aktiviert, wachhält und erst so dauerhaft in die Stadtgesellschaft hineinwirkt. Ihre Aufklärungsmethode zielte dabei auf die Herausarbeitung und Nutzung der zahlreichen authentischen Gegebenheiten des Ortes als Grundlage für Selbsterkundungen, d.h. für das Vergegenwärtigen von Realgeschichte in Verbindung mit eigener Lebensgeschichte. Diese Methode sucht Erinnern und Behalten also nicht allein durch Belehren oder Mahnen zu fördern. Es geht um Wachhalten einer affektiven Erschütterung als wesentliche Voraussetzung für engagiertes politisches Handeln. Den Doppelcharakter des Ortes Friedberger Anlage erfahrbar zu halten, die ausgegrabenen Synagogen-Trümmer auf körperlich spürbare Weise von ihrer Geschichte sprechen zu lassen, das provozierend Abstoßende aus dem „Abgrund der Geschichte“ (Piccard) zu zeigen und nicht zu bereinigen, zu überbauen, umzubiegen, zu verleugnen, das also gehörte und gehört weiterhin zum Arbeitsziel der Initiative. Daran festzuhalten betrachten wir als wichtigste erinnerungspolitische Maßnahme.
Unserer Bürgerinitiative ging es nicht nur darum, an die Ortsgeschichte zu erinnern, sondern den Ort so zu gestalten, dass er – als Mahnung und Menetekel gelesen – erschreckt und davon ausgehend zu einem engagierten Handeln gegen Wiederholungen antisemitischer und rassistischer Verbrechen beiträgt. Fragen wir rückblickend, ob wir das erreicht haben, so fanden sich bei Besuchern unserer Ausstellungen und Teilnehmern unserer Veranstaltungen dafür immer wieder überzeugende Belege. Ein Großteil unserer Arbeit hatte – worauf hier nicht weiter eingegangen wurde – hatte zum Ziel, uns in einem umfassenderen Verbund oder einem Netzwerk ähnlicher anti-rassistischer und anti-antisemitischer Organisationen, Institutionen usw. einzubetten. Die Initiative wirkte nun in einem großen Orchester mit besonderer Stimme.
Ein nicht geringer Anteil unserer Arbeit zielte schließlich darauf, städtische Institutionen, Parteien, Justiz, Polizei, Schulen, Religionsgemeinschaften, Medien für uns zu gewinnen. Damit wollten wir unsere institutionelle Basis „politisch“ weiter sichern und ausbauen. Es galt, sie auf uns aufmerksam zu machen und von der Bedeutung unseres Projektes zu überzeugen. So sehr eine Stadt und gute Stadtpolitik von Initiativen lebt und deren Entwicklung fördern müssen, so leben auch Initiativen von Stadtpolitik, gerade auch dann, wenn sie nicht nur ihr verlängerter Arm oder Alibi sein wollen.
Das betrifft besonders einen Punkt, an dem unsere Initiative insofern nur noch als Impulsgeber fungieren kann, weil ihr die finanziellen und organisatorischen Mittel zur Ausgrabung der Fundamente und weiteren Ausgestaltung des Ortes unvermeidlich fehlen. Dafür müssen sich Stadt, Museen, (Sponsoren, Jüdische Gemeinde usw.) engagieren. Das verlangt von ihr einen schwierigen politischen und finanziellen Spagat. Denn zugleich muss anerkannt bleiben, dass der Ort als Arbeitsort einer unabhängigen Gruppe bürgerschaftlichen Engagements weiterbestehen kann, nicht bürokratisert, nicht „institutionell eingemeindet und verwaltet“ wird. Denn so erst kann das Projekt dauerhaft Bestandteil der Frankfurter Kulturszene bleiben, als Werk bürgerschaftlichen Engagements aufgefasst und überliefert werden. Die Initiative selbst ließe sich so als eine Art Bürger-Kuratorium verstehen, aus ihren Mitgliedern würden freie Mitarbeiter, ideelle Träger und zugleich Garanten des Gesamtprojektes werden. Gelänge dies, dann hätte die Initiative 9. November e.V. nicht mehr und nicht weniger ein neues demokratisches „Stiftungsmodell“ hervorgebracht.
24.03.2022 Wolfgang Leuschner
